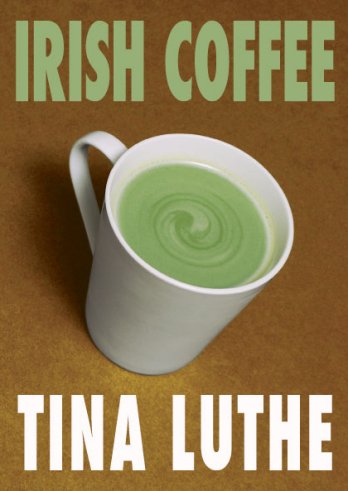
| Start | > Leseproben < | Lebenslauf | Fotos | Friends | Kontakt |
Leseprobe: Irish Coffee
10. Mai
Stefano steht im vorderen Teil des kleinen Bootes, hält das Ruder in beiden Händen und bemüht sich, so auszusehen, als sei es eine seiner leichtesten Übungen, uns vom Ufer weg zu manövrieren, doch kostet es ihn in Wirklichkeit eine Menge Kraft. Dabei sieht er so feierlich aus, dass zu befürchten steht, er breche jeden Moment in ein schallendes O sole mio aus, und ich muss lachen. "Wie ein venezianischer Gondolière", kommt mir in den Sinn, und ich finde die ganze Angelegenheit fast romantisch, bis mir auffällt, dass die Szenerie ein paar gravierende Mängel aufweist, wie ein Suchbild, in dem man eine bis hundert Ungereimtheiten entdecken soll. Erstens befinden wir uns nicht in Venedig, sondern auf dem endlosen Lago di Bolsena, der nicht einmal ansatzweise die räumliche Beschränktheit der Kanäle vermitteln kann. Zweitens trägt mein Gondolière eine Badehose, einen Strohhut und eine grauenhafte, geschweißte Sonnenbrille, und er hat, bei aller Liebe, nicht viel Erfahrung in dem, was er hier tut. Drittens hat er ein bisschen zu viel getrunken. Das haben wir beide. Obwohl erst Mittag ist. Viertens wird die Idylle erheblich gestört durch eine Horde junger Menschen, die am Ufer stehen und uns Dinge zurufen. Bei genauerem Hinhören entpuppt sich dies als Wut darüber, dass wir ihnen vor der Nase weggefahren sind, ohne sie ebenfalls ins Boot einsteigen zu lassen, das zweifelsohne Platz genug für uns alle bietet. War nur so eine Laune, kein Grund für derart wüste Beschimpfungen. Allora: keine Ode an die Sonne, sondern Umkehr. Ich genieße noch einen weiteren Augenblick den Sonderstatus als einziger, verwöhnter Passagier, dann nehmen wir die anderen an Bord, samt Proviant, der aus einer 5-Liter-Korbflasche Wein und einem halben Dutzend Gläsern besteht. Mit nunmehr sieben Passagieren an Bord hat Stefano gegen die Wassermassen nicht den Hauch einer Chance, und statt O sole mio durchschneidet daher das Geräusch des Außenbordmotors die mittägliche Stille am See. Das Boot trägt uns schnell weiter auf den See hinaus, so weit, dass ich meine, am gegenüberliegenden Ufer die Häuser von Valentano ausmachen zu können. An dieser Stelle stoppt Stefano das Boot, schaltet den Motor ab, und wir dümpeln friedlich dahin. Jemand öffnet die Weinflasche, und aus mehreren Richtungen strecken sich ihm sogleich die Gläser entgegen. Die Entspannung ist vollkommen. Einige von uns nehmen eine Sonnen anbetende Position ein, andere sehen sich genötigt, mit einem Kopfsprung ins kühle Wasser zu tauchen. Auch Stefanos Strohhut ereilt das kühle Naß. Eine Weile sehen wir teilnahmsvoll zu, wie er auf den Wellen treibt, bevor er sich in seine Einzelteile zerlegt, lange, geflochtene Fäden. Dem einen oder anderen mag an dieser Stelle in den Sinn kommen, den Hut vor dem nassen Grab zu bewahren, aber dann wieder gefällt uns der Gedanke, der Hut wird an diesem Ort verbleiben, für den er von Anfang an gedacht war. Es gibt wenige Orte, an denen man die Zeit vergessen kann. Dies ist ganz sicher einer davon. Eine schiere Ewigkeit sehen wir dem Zersetzungsprozeß des Strohhutes zu, bis sich einer von uns doch erbarmt und ihn wieder an Bord nimmt. Nichts stört die perfekte Idylle. Wir erproben uns in der hohen Kunst, Wein aus einer vollen Korbflasche in schmale Gläser zu füllen, indem wir uns die Korbflasche über die Schulter legen. Eine komplizierte Prozedur, aber vollendet stilvoll.
Als die Flasche schließlich geleert und wir alle mindestens angeheitert sind, steuern wir das Boot in die Nähe des Hafens, steigen über den Rand ins knietiefe Wasser und ziehen es an Land. Ich komme mir vor wie in der Bacardi-Werbung. Wir nehmen in einem kleinen Eiscafe Platz, bestellen alle Sorten Magnum durcheinander, werfen ein halbes Vermögen in die Jukebox und wählen nur ein einziges Lied. 'Please forgive me' von Bryan Adams. Wir reden nicht viel, schlecken an unserem Eis und starren auf den Sonnen beschienenen See hinaus. Und auf einmal bin ich mir sicher, dies ist einer der glücklichsten Momente in meinem Leben und ich versuche, so gut ich kann, ihn in meinem Gedächtnis zu bewahren.
Abends sitzen wir um das Lagerfeuer und grillen. Nach dem Essen folgt die alt gewohnte Zeremonie, auf die keiner mehr verzichten mag: Stefano holt seine Geige hervor, Lukas überredet seine Gitarre zur Akkordtreue, und wir anderen singen entweder mit oder hängen unseren eigenen Gedanken nach, während wir in die Flammen starren. Obwohl ich das nicht möchte, obwohl ich mich den anderen weiterhin so nah wie immer fühlen möchte, driften meine Gedanken ab in schmerzhaft vertraute Gefilde.
Warum um alles in der Welt ist das so schwer? Alles, was ich mir wirklich wünsche, ist in Momenten wie diesem einen klaren Kopf. Ich habe schon Unmöglicheres verlangt und auch bekommen, oder nicht?
Nur ein paar Minuten für mich selber, ohne die Musik, die Landschaft, die mahnenden Worte - und vor allem dieses Gesicht, dieses unverwechselbare, schmerzhaft vertraute Gesicht vor meinem inneren Auge. Wenn man etwas partout nicht sehen will, verschließt man die Augen und träumt sich an einen fernen Ort. Wenn man etwas nicht hören mag, verschließt man die Ohren mit beiden Händen und summt leise und beharrlich eine schiefe Melodie vor sich hin. Wie aber soll man sich vor etwas schützen, das sich über Monate hinweg unwiderruflich in Bildern, in Tönen, in Gefühlen in meinen Verstand hinein gegraben hat und einfach nicht weichen will, nicht dem Summen, nicht den Film reifen Gedanken an aufregende Orte und aufregende Dinge? Auf Schritt und Tritt verfolgt es mich und - wer weiß, woher - es hat diese unangenehme Angewohnheit, immer dann die Oberhand zu gewinnen, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Tatsächlich, für Momente glaubt man allen Ernstes, man hat es überlistet und kann sich der Gegenwart widmen, man holt tief Luft und - bäng! - da ist es wieder und lacht sich ins Fäustchen darüber, wie man nur so naiv sein konnte, zu glauben, alles sei wirklich sooo einfach. Seit wann kann man sich aussuchen, was man fühlt? 'Pech gehabt', sagt es, und 'Selber Schuld', und ich weiß bereits aus Erfahrung, was das heißt. Ich hätte eben damals die Augen, die Ohren, die Sinne verschließen sollen, als es passierte. Ich hätte dann immerhin den Glauben an mich, mein unerschütterliches Selbstbewusstsein und den Traum einer verzauberten Insel im Atlantik bewahrt. Das wird Irland nach all den Erfahrungen, dem Glück, den Tränen und der Fassungslosigkeit nie wieder seinSie werden zuhören, und sie werden sich vielleicht sogar bemühen, mich wirklich zu verstehen. Aber niemand kann eher als ich verzeihen, dass sie irgendwann die Geduld verlieren werden und sagen, Du sollst endlich aufhören, in der Vergangenheit zu leben und Dich der Gegenwart stellen. Genau der Moment, in dem mir einmal mehr die Worte fehlen werden, zu erklären, wie es sich anfühlt, irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft gefangen zu sein. Dann werde ich ihnen von meinem geheimsten Wunsch erzahlen, nämlich, dass niemand mehr als ich selber von diesen Gefühlen Abstand gewinnen will, wenn auch nur für kurze Zeit. Und Du wirst innerlich lachen, und es wird auch lachen, weil es Dich beim Lügen ertappt hat. Dann doch lieber schweigen....
Ist es unser Stolz, der uns in diese Sackgasse getrieben hat, hinein in ein Leben ohne den anderen, mit vollkommener Kontrolle über das, was wir tun und die, die wir sind? Es gab eine Zeit, da wäre uns diese unvollkommene Vollkommenheit zuwider gewesen. Es ist einfach, aus einem gemeinsamen Leben im Handumdrehen zwei getrennte zu machen, wenn ganze Länder dazwischen liegen. Die, die über uns berichten könnten, schweigen beharrlich, schweigen aus Rücksicht, schweigen aus Erleichterung über das Ende der nass geweinten Schultern und des euphorischen Überschwangs, über das Ende einer Zeit, die sie zu Mitwissern und Mittätern gemacht hat und sie bisweilen zu bloßen Zuschauern degradierte.
17. Mai
Noch zehn Minuten bis zur Landung. Als ich das letzte Mal herkam, hatte genau an dieser Stelle der Nebel dem Ausblick Platz gemacht, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Unter mir die Irische See, das Sonnenlicht in abertausend glitzernden Sternen wiedergebend, und dann schon, weiter vorne, Dublin Bay in der Morgensonne, umstrahlt von einem orangefarbenen, ausgewaschenen Licht. Es ist mir niemals gelungen, das zu beschreiben, was ich damals sah, oder vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht versucht, weil ich wusste, dass Worte zu wenig sind für ein solches Geschenk der Natur - und als eben das habe ich es immer empfunden. Ein Wiedersehen-Geschenk. Wie wird Irland mich diesmal begrüßen? Auf den Anblick von Dublin Bay im Sonnenlicht könnte ich diesmal vielleicht sogar verzichten - nicht aber auf die Wärme, die immer da war, seit ich zum ersten Mal einen Fuß auf diese Insel gesetzt habe. Die mich umfangen hielt, wie Dublin Bay damals von der Sonne umfangen wurde und mich immer vor der Kälte beschützt hat. Natürlich habe ich mir längst eine Version zurechtgelegt, die mich unschuldig aussehen läßt. Als ob es darum ginge, wer aus dieser Schlacht hocherhobenen Hauptes hervorgeht. Als ob es überhaupt um etwas anderes ginge als um die augenscheinliche Unfähigkeit zweier Menschen, im Dickicht der Möglichkeiten den Weg entschlossen zu gehen, von dem man sich noch vor Monaten sicher war, es sei der einzige und der wahre Weg. Und das, obwohl es dabei auch der verschlungene und unebenste aller Wege war. Wie tapfer wir waren und wie entschlossen, und wie stark wir uns fühlten, wie unbesiegbar, obwohl doch 'sie' ständig die Vernunft, die Erfahrung und die Moral auf ihrer Seite hatten, und - bei Gott - das waren starke Gegner.
Kraft, die wir ausschließlich aus der Nähe und dem Trost des anderen schöpften. Eine Nähe, in die uns niemand folgen konnte, ein Ort, der von Anfang an ganz allein gehörte, einer von wenigen. Ich habe nie verstanden, warum unser Glück eine solche Bedrohung für sie war, und sie haben sich nie die Mühe gemacht, es uns zu erklären. Es wäre zu einfach, zu sagen, alles sei ihre Schuld. Denn wir wussten, woran wir waren, und wir wussten auch, dass, wenn sie zuschlugen, ihre Schläge stets hart und präzise trafen. Wir wussten, woran wir waren, und wir konnten uns doch nicht dagegen wehren. Und würde uns beide jetzt jemand fragen, wen wir verantwortlich machen für den augenblicklichen Stand der Dinge, ich bin mir sicher, wir würden mit dem Finger aufeinander zeigen. Was ist bloß aus uns geworden, den mutigen, entschlossenen Helden? Irgendwo entlang unseres Weges müssen wir bequem geworden sein und des ewigen Kampfes müde, und das hat uns anfällig gemacht für Angriffe von außen, für Zweifel und die verlockende Aussicht auf einen mühelosen Weg, nicht so einzigartig zwar, doch gerade und breit. Einzigartig kann er nicht gewesen sein, denn sonst wäre ich jetzt nicht hier, kurz vor Dublin, getragen von der Hoffnung, dass der Nebel sich lichtet. Und wieder muss ich daran denken, wie alles begonnen hat, damals, am anderen Ufer eines ganzen Meeres von Zeit.